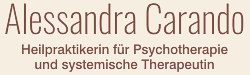Alessandra Carando
Heilpraktikerin für PsychotherapieSystemische Therapeutin
M.A. Politikwissenschaften
Telefon: 0179 615 61 37
Kontaktformular
Aktuelles

In der Neuropsychotherapie werden die Ergebnisse der Psychologie und der Psychotherapie mit den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung verknüpft. Es wird davon ausgegangen, dass Psychotherapie, nicht nur auf die Seele, sondern auch auf die physiologischen Strukturen des Gehirns wirkt. Wenn äußere Erfahrungen, insbesondere die Erfahrungen mit anderen Menschen, nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch das Gehirn prägen, dann ist es möglich, dass auch die durch Psychotherapie verursachten Veränderungen auch eine relevante Wirkung haben. Frühe Erfahrungen, die sich im Gehirn niedergeschlagen haben, werden durch neue Erfahrungen, die im Kontakt mit dem Psychotherapeuten entstanden sind, überschrieben und im Gehirn verankert.
Unsere Gedanken und Empfindungen sowie unsere Fähigkeiten und Verhaltensweisen haben im Gehirn ihre materielle Grundlage. So zeigt sich beispielweise die Fähigkeit, ein Instrument spielen zu können in den neuronalen Strukturen: Untersuchungen von Wissenschaftler wie Elbert und Taub können zeigen, dass das Gehirnareal, in dem die Fingerfertigkeit der linken Hand repräsentiert wird, bei einem Violinist vergrößert ist. In einer Studie von Maguire fand sich bei erfahrenen Taxifahrer eine Volumenvergrößerung des Bereichs im Gehirn, der für die räumliche Orientierung zuständig ist.
Ebenso hinterlassen unsere Gedanken und Gefühle spuren im Gehirn. Ermöglicht werden diese Erkenntnisse unter anderem durch bildgebende Verfahren, mit denen die Aktivität bestimmter Gehirnareale sichtbar gemacht werden können. Mit Hilfe der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder auch der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) kann konkret festgestellt werden, welche Bereiche bei welche Denkleistung und bei welche Gefühlzuständen und Handlungen aktiv sind.
Jahrhunderte lang galt es als wissenschaftlich anerkannt, dass unser Gehirn, sobald es einmal im Erwachsenalter angekommen ist, nicht mehr formbar ist und dass keine neuen neuronalen Verbindungen mehr in unserem Gehirn entstehen. Dies hielt sehr lange an, bis die Wissenschaft einen erstaunlichen Prozess namens Neuroplastizität entdeckte. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns sich selbst zu ändern und sich weiterzuentwickeln. Menschen sind also in der Lage durch Gedanken und Übung ihre Gehirnstruktur zu beeinflussen und zu formen.
Gedanken, Gefühle und Handeln
Im Rahmen einer Psychotherapie werden weitere neue Erfahrungen gemacht, neue Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen angeregt und bestärkt. Die Fokussierung auf das Problem ist ungünstig: Denn durch sie werden die der Krankheit zugrunde liegenden neuronalen Muster erneut aktiviert und damit gestärkt. Wichtig ist zudem, dass unbewusste neuronale Muster verändert werden.
Die kognitiven Therapieverfahren, zu denen die Kognitive Therapie nach Aaron Beck (KT) und die Rational-Emotive Therapie nach Albert Ellis (RET) gehören, gehen davon aus, dass die Art und Weise, wie wir denken, bestimmt, wie wir uns fühlen, wie wir handeln und körperlich reagieren. Das grundlegende theoretische Modell menschlichen Erlebens und Verhaltens ist für Beck und Ellis gleich verbindlich. Es besagt im Wesentlichen das, was bereits der antike Philosoph Epiktet (50 – 138 n. Chr.) formuliert: „Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Vorstellungen von den Dingen“. Das ist ein Satz, der in zahlreichen Lehrbüchern zur Kognitiven Therapie zitiert wird. Der Mensch kann, durch die kognitive Verarbeitung (Interpretation und Bewertung) von bestimmten Ereignissen und Situationen in seinem Leben, sein aktuelles Erleben und Verhalten selbst steuern oder mindestens beeinflussen. In anderen Worten geht das kognitive Modell davon aus, dass Gefühle und Verhaltensweisen von Personen durch die Wahrnehmung bzw. Interpretation von Situationen beeinflusst werden.
In Vergleich zu analytischen Psychotherapien ist die kognitive Verhaltenstherapie eine kurzzeitige Behandlung. Manchen Menschen geht es bereit nach wenigen Sitzungen deutlich besser, bei anderen ist eine Behandlung über mehrere Monate nötig. Ein Einzelgespräch dauert in der Regeln 60 Minuten und die Sitzungen finden üblicherweise einmal pro Woche statt. Kognitive Verhaltenstherapien werden in Praxen für Psychotherapie und Kliniken angeboten, teilweise auch als Gruppentherapie oder online mithilfe digitaler Medien.
Alessandra Carando
Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Therapeutin
M.A. Politikwissenschaften
Definition von Krise und Krisentypen
„Krise ist ein Ereignis oder eine Situation, die als untragbare Schwierigkeit wahrgenommen wird und welche für die betroffene Person vorhandenen oder im Moment zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien überfordert“ (James, Gilliland, 2017, Crisis Intervention Strategies, S.10). Bei einer ‚Krise‘ bestehen Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft, wenngleich das psychische Gleichgewicht labil ist. Beim ‚Notfall‘ ist die Gefährdung bereits derart eskaliert, dass weder von Kommunikationsfähigkeit noch von Kooperationsbereitschaft ausgegangen werden kann: Das psychische Gleichgewicht ist verloren gegangen und es besteht das ernste Risiko einer akuten Selbst- und/oder Fremdgefährdung. Die Notfallintervention ist erst beendet, wenn keine akute Gefährdung mehr besteht. Diese kann in eine Krisenintervention übergehen, sobald keine akute Selbst- und Fremdgefährdung mehr besteht und die Betroffenen in der Lage und bereit sind, Vereinbarungen mit dem Krisenhelfer einzuhalten. Wenn in einer Krisen- oder Notfallsituation professionelle Hilfe angefordert wird, muss davon ausgegangen werden, dass die bisherigen Ressourcen im Umfeld des Klienten stark beansprucht oder gar erschöpft sind.In der Literatur wird zwischen Lebensveränderungskrise (Entwicklungskrise) und traumatischer (situativer) Krise unterschieden. Beispiele für Lebensveränderungskrisen im sozialen Feld sind u.a. Trennung, Partnerverlust, Arbeitslosigkeit, Umzug, Geburt eines Kindes, Todesfälle in der Familie oder finanzielle Schwierigkeiten. Lebensveränderungskrisen können auch biologische Anlässe haben, z. B. Klimakterium, Pubertät, Krankheit oder Behinderung.
Anlässe für traumatische Krisen sind plötzliche Schicksalsschläge wie der Tod des eigenen Kindes, Naturkatastrophen, sexuelle Gewalt und Missbrauch. Bei traumatischen und Lebensveränderungskrisen ist das Ziel der Intervention, den Betroffenen zu stabilisieren und erst danach die Bearbeitungsprozess einzuleiten (z.B. Prioritäten setzen und Ressourcen unterstützen).Umgang mit emotionalen Krisen
Im Verlauf jeder Behandlung können emotionale Krisen und Phasen plötzlicher Verschlechterung eintreten. Ziel ist es, diese Schwierigkeiten aufzufangen und den Klienten die Möglichkeit zu geben, mit solchen Krisen in konstruktiver Weise umzugehen. Jedem Klienten soll die Möglichkeit offenstehen, in Notsituationen (z. B. Stimmungstief, suizidale Ideen) den behandelnden Therapeuten anzurufen bzw. anzusprechen. Ferner sollen Patienten über persönlich bekannte psychotherapeutische Vertreter informiert sein, falls in einer Krise der aktuelle Therapeut persönlich nicht erreichbar ist. Eine sichere Bindung mit dem Therapeuten ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Stabilisierung des Klienten.Zu den zentralen Verhaltensmerkmalen eines Therapeuten bei Krisen zählen die beruhigenden Versicherungen. Sie wirken nur dann beruhigend auf Patienten, wenn diese merken, dass die persönlichen Schwierigkeiten von den Therapeuten anerkannt werden, und wenn gleichzeitig deutlich gemacht wird, wie man aus der Krise heraushelfen kann.
Es gelingt zahlreichen Menschen, ihre emotionalen Krisen zu überwinden. Dafür stehen erfolgreiche Therapiealternativen zur Verfügung. Entscheidend ist dabei immer, auch wenn es schwerfällt: anfangen, handeln, aktiv werden, verändern, nicht länger vermeiden und nicht resignieren. Die Beschäftigung mit Menschen in Krisen und mit Suizidgefährdeten bringt den Helfer selbst auch mit seiner eigenen Krisenanfälligkeit und Einstellung zum eigenen Sterben und Tod in Kontakt. Je besser der Helfer seinen eigenen Sinn des Lebens erarbeitet hat, desto eher wird er den bedrängten, sich in einer Krise befindlichen Menschen auf der Suche nach deren Sinn begleiten können.
Alessandra Carando
Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Therapeutin
M.A. Politikwissenschaften
Suizid: ein Tabu unserer Gesellschaft
Historisch wird Suizid in unserer Gesellschaft überwiegend abgelehnt. Obwohl es in der Bibel sich kein ausdrückliches Suizid-Verbot findet, stimmen zahlreiche Kirschenlehrer seit der Theologe Augustin in der Ansieht überein, dass Selbsttötung dem göttlichen Schöpfungsakt wiederspricht. Daher wurden früher die sogenannten ‚Selbstmörder‘ außerhalb der christlichen Friedhöfe als ehrlos verscharrt.
Der Anstoß, Suizidenten würdig zu bestatten, kam durch die Aufklärung und in Deutschland auch durch den preußischen Staat: Im Allgemeinen Preußischen Landrecht wurde dann 1794 diese Diskriminierung des ‚Selbstmörders‘ untersagt und ihnen ein ehrliches Begräbnis auf dem Friedhof zugestanden. Die Kirchen brauchten noch einmal gut 100 Jahre, bis auch sie die diskriminierende Haltung langsam aufgaben. Der Suizid ist seit dem 19. Jahrhundert nach deutschem Recht kein Straftatbestand.
Risikofaktoren für Suizidalität
Der Suizid wird zunehmend ein Phänomen des höheren Lebensalters. Im Jahre 2013 betrug das durchschnittliche Lebensalter eines durch Suizid verstorbenen Menschen 57,4 Jahre. Bei Frauen stieg auf 59,4 Lebensjahre.
Alle psychischen Erkrankungen gehen mit erhöhter Suizidgefahr einher: 90% der Suizide liegen psychische Erkrankungen zugrunde. Dazu gehören:
Depressive Episode (60%)
Alkohol- und Drogenabhängigkeit (15%)
Schizophrene Psychosen (10%)
Persönlichkeitsstörungen (5%)
Schwere (chronische) körperliche Erkrankungen sind in bis zu 50% der Suizide ein entscheidende Faktor. Betroffenen Menschen fällt es schwer über ihre Suizidgedanken mit ihrem Arzt oder Therapeuten zu sprechen - nicht selten auch während der Behandlung einer Erkrankung, wie einer Depression -. Aus Studien ist bekannt, dass Menschen vor einem vollendeten Suizid viel häufiger als üblich einen Arzt aufgesucht haben, die Suizidgefährdung aber nicht erkannt wurde. Häufig besteht die Angst darin, nicht ernst genommen zu werden, soziale Kontakte zu verlieren, als psychisch krank bezeichnet zu werden und vor Autonomieverlust durch zwangsweise Behandlung. Außerdem haben nicht wenige die Vorstellung, dass sie niemand verstehen und niemand ihnen helfen könne. Diese Ängste und Vorstellungen ergeben sich aus der psychischen Befindlichkeit der Betroffenen.
Wie können wir in unserer Gesellschaft mehr Toleranz für Krisen entwickeln?
Suizid und Suizidversuch sind bis heute ein Tabu geblieben: Auch in unserer aufgeklärten Leistungsgesellschaft wird der Umgang mit dem Thema Suizid nach wie vor gerne weggeschoben. Die mit einer solchen Tabuisierung oft einhergehende Scham der Betroffenen und ihrer Angehörigen erschwert den Umgang mit der lebensbedrohlichen Krise zusätzlich. Menschen in einer schweren persönlichen Krise mit Selbsttötungsabsichten sind kaum noch in der Lage, sich Hilfe zu holen. Sie sind somit auf Unterstützung von aufmerksamen Mitmenschen angewiesen. Angehörige oder Freunde sind jedoch in aller Regel überfordert, wenn sie bei einem geliebten Menschen Anzeichen einer möglicherweise beabsichtigten Selbsttötung entdecken. Aufklärungskampagnen mit dem Ziel bestehende Vorurteile und gesellschaftliche Stigmatisierung abzubauen sind ein wichtiger Bestandteil der Suizidpräventionsprogramme in Deutschland. In der öffentlichen Meinung gibt es noch viele Vorurteile zum Thema Suizid, die irreführend und falsch sind.Faxit
Suizide sind ein globales Phänomen. Alle Länder sind davon betroffen. Es gibt Hinweise darauf, dass auf jeden Erwachsenen, der durch einen Suizid stirbt, mindestens 20 Personen kommen, die einen Suizidversuch begehen.
Trotz der allgemeinen Meinung, dass Suizide häufiger in Ländern mit hohen Einkommen verübt werden, geschehen tatsächlich 75 % der Suizide in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Suizid ist während der gesamten Lebensdauer eine häufige und bedeutsame Todesursache. Außer den Auswirkungen auf Einzelpersonen, die Suizidversuche unternehmen und durch Suizid sterben, wirken sich Suizide auch weitreichend und wellenartig auf Familien, Freunde, Kommunen und Länder aus.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Beschränkung des Zugangs zu tödlichen Mitteln und Methoden beispielsweise sehr vielversprechend und wirkt. Eine effektive Strategie zur Prävention von Suiziden und Suizidversuchen ist daher die Beschränkung des Zugangs zu den häufigsten Suizidmethoden- und mitteln, wie Pestiziden, Schusswaffen und bestimmten Medikamenten.
Suizidprävention sollte als Kernkomponente in das nationale Gesundheitssystem integriert sein. Psychische Erkrankungen und Alkoholmissbrauch sind Ursachen für sehr viele Suizide weltweit. Frühe Erkennung und effektives Management sind der Schlüssel dafür, dass Betroffenen die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Darüber hinaus spielen Gemeinden eine entscheidende Rolle in der Suizidprävention. Sie können soziale Unterstützung für Betroffenen bieten und sich in der Nachsorge, Stigma-Bekämpfung und bei der Unterstützung für Angehörige eines Suizidopfers engagieren.
Alessandra Carando
Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Therapeutin
M.A. Politikwissenschaften